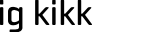Neue Kunstförderungsrichtlinie des Bundes
Mit 1. Juli 2025 sind neue Richtlinien für die Kunst- und Kulturförderung des Bundes in Kraft getreten. Die Neuregelung bringt eine Reihe an Klarstellungen, punktuellen Erleichterungen sowie zusätzliche Anforderungen mit sich. Besonders für Kulturinitiativen, die Förderanträge stellen, lohnt sich ein genauer Blick.
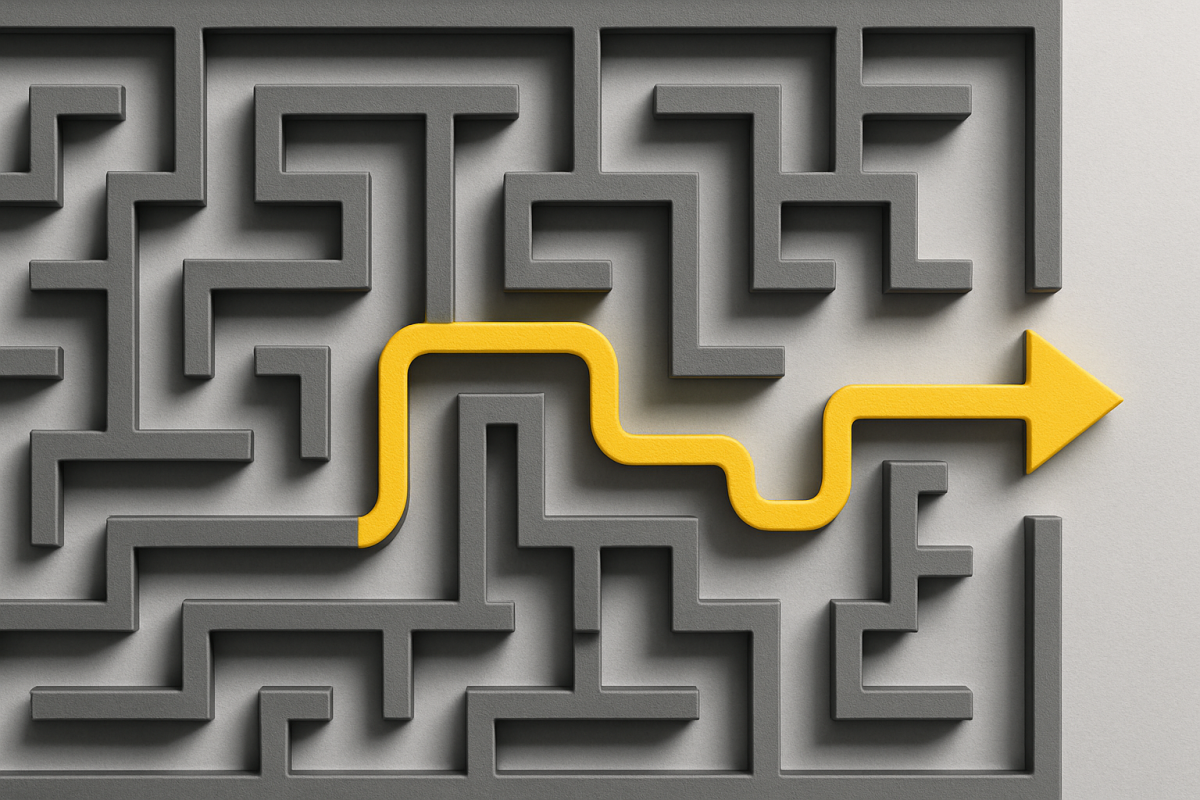
Hinweis: Update am 15. September durch die Veröffentlichung der FAQs zu Kinderschutz- und Präventionskonzepten seitens des BMWKMS;
Seit 1. Juli 2025 gelten neue Richtlinien des Bundesministeriums für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport für die Gewährung von Förderungen nach dem Kunstförderungsgesetz – kurz Kunstförderungsrichtlinie. Wer eine Bundesförderung erhält, akzeptiert diese Richtlinien sowie die Allgemeinen Rahmenrichtlinien für Förderungen aus Bundesmitteln (ARR 2014) automatisch und vorbehaltlos. Ein genauer Blick auf das "Kleingedruckte" ist somit unerlässlich, um Klarheit über die allgemeinen Fördervoraussetzungen, förderbare Kosten und Abrechnungsmodalitäten zu erhalten.
Ausgewählte Änderungen im Detail:
- WAS kann gefördert werden – Förderungsgegenstand
Auf Grundlage des Kunstförderungsgesetzes werden weiterhin das künstlerische Schaffen und dessen Vermittlung in verschiedenen Sparten wie Darstellende Kunst, Musik, Film, Bildende Kunst, Literatur und weitere gefördert. Neu präzisiert wurde, dass neben der Veröffentlichung, Präsentation und Dokumentation von Werken explizit auch deren Vermittlung, Archivierung, Verbreitung sowie Querschnittsthemen, die die Digitalisierung betreffen und/oder interdisziplinären bzw. transversalen Charakter haben, gefördert werden können. Eine wichtige Ergänzung ist die explizite Förderbarkeit von Maßnahmen zur Stärkung der Inklusion von Menschen mit Behinderung innerhalb der genannten Bereiche.
Von einer Förderung ausgeschlossen sind weiterhin rein kommerzielle Programme, Projekte von Laien und Amateur:innen, Projekte im Rahmen universitärer Studien, Projekte mit reinem sozialen oder karitativen Charakter (z.B. Benefizveranstaltungen) oder Vorhaben, die vorwiegend wissenschaftliche oder religiöse Zwecke erfüllen. Ebenso ausgeschlossen ist die Förderung reiner Produktionskosten ohne konkreten Verwertungsplan oder öffentliche Zugänglichmachung bzw. Präsentation. Projekte, die (mit Ausnahme von EU-Projekten) bereits Teil von vom Bund geförderten Projekten oder Jahrestätigkeiten sind, können ebenfalls nicht zusätzlich gefördert werden.
- WER kann gefördert werden – Förderungswerber:in
Die Regelungen für Förderungswerbende sind nun wesentlich detaillierter. Ein erforderlicher Österreichbezug wird klargestellt: Förderwerbende müssen entweder ihren Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt, eine Betriebsstätte oder ihren Sitz in Österreich haben, oder österreichische Staatsbürger:innen mit Wohnsitz im Ausland sein, oder Projekte mit Österreich-Bezug durchführen, die Österreich im Ausland repräsentieren.
Bei Vorhaben, die von mehreren Förderungswerbenden gemeinsam beantragt und durchgeführt werden sollen, ist nun klar geregelt, dass der Förderungsvertrag mit allen Beteiligten abzuschließen ist. Die Koordination erfolgt über eine im Vertrag genannte Person, und alle beteiligten Förderwerbenden müssen eine Solidarhaftung für die Rückzahlung im Falle eines Rückzahlungsgrundes übernehmen. Voraussetzung hierfür ist der Abschluss einer Konsortialvereinbarung zwischen den Förderungswerbenden.
- UNTER WELCHEN BEDINGUNGEN kann gefördert werden – Allgemeine Förderungsvoraussetzungen
Die bewährten formalen Anforderungen bleiben bestehen: Eine Förderung ist nur zulässig, wenn die Gesamtfinanzierung des Projekts durch die Bundesmittel gesichert erscheint. Es muss ein Anreizeffekt vorliegen, d.h. das Vorhaben kann ohne die Förderung nicht oder nicht im notwendigen Umfang durchgeführt werden. Eine finanzielle oder sachliche Eigenleistung der:des Förderwerbenden ist grundsätzlich zu erbringen, sofern wirtschaftlich zumutbar. Eine angemessene Beteiligung anderer Gebietskörperschaften ist anzustreben, wenn deren Interessen berührt sind. Grundsätzlich darf mit der Leistung nicht vor Gewährung der Förderung begonnen worden sein, es sei denn, besondere Umstände rechtfertigen eine nachträgliche Gewährung von Kosten, die nach Antragstellung entstanden sind. Zudem müssen Zweifel an der ordnungsgemäßen Geschäftsführung und Durchführung ausgeschlossen sein, und frühere Förderungen müssen fristgerecht, vollständig und widmungsgemäß abgerechnet worden sein. Bestehende Rechtsvorschriften wie das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz und das Behinderteneinstellungsgesetz sind weiterhin zu beachten.
Neu hinzugekommen sind jedoch wichtige qualitative Anforderungen. Förderwerbende müssen nunmehr:
- ausreichend dafür Sorge tragen, dass jeder Form von Missbrauch, Belästigung, Einschüchterung, Entwürdigung oder Beleidigung entgegengewirkt wird. Ab einer Förderungshöhe von EUR 50.000 für die Jahrestätigkeit ist ein entsprechendes Präventionskonzept vorzulegen. Ab einer Förderungshöhe von EUR 100.000 für die Jahrestätigkeit ist zusätzlich ein externer Meldekanal für Hinweisgeber:innen (Whistleblowing-Kanal) bereitzustellen.
→ siehe auch FAQs zu Kinderschutz- und Präventionskonzepten, BMWKMS, September 2025
→ siehe auch Materialien und Hilfestellungen von vera* – Vertrauensstelle Kunst und Kultur
- für den Fall, dass Projekte oder Vorhaben unter Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen erfolgen, muss zusätzlich vor Projekt- oder Vorhabensbeginn ein Kinderschutzkonzept vorgelegt werden.
→ siehe auch FAQs zu Kinderschutz- und Präventionskonzepten, BMWKMS, September 2025
- im Rahmen ihrer Möglichkeiten ausreichend dafür Sorge tragen, dass den Empfehlungen des "Leitfadens für Kultureinrichtungen im Umgang mit Drittmitteln aus Sponsoring und sonstigen Zuwendungen" sinngemäß entsprochen wird.
- sich an den Nachhaltigkeitszielen des Bundes im Bereich Kunst und Kultur orientieren, wobei ein besonderes Augenmerk auf eine ressourcensparende Kulturproduktion zu legen ist.
- grundsätzlich auf eine faire und angemessene Bezahlung achten.
Für Jahresförderungen gibt es zudem weiterhin eine Voraussetzung an die Statuten:
Jahresförderungen dürfen nur an Einrichtungen erfolgen, deren statuten- oder satzungsmäßige Hauptaufgabe die Verfolgung von Zielen gemäß §§ 1 und 2 Abs 1 und 2 des Kunstförderungsgesetzes ist.
- ausreichend dafür Sorge tragen, dass jeder Form von Missbrauch, Belästigung, Einschüchterung, Entwürdigung oder Beleidigung entgegengewirkt wird. Ab einer Förderungshöhe von EUR 50.000 für die Jahrestätigkeit ist ein entsprechendes Präventionskonzept vorzulegen. Ab einer Förderungshöhe von EUR 100.000 für die Jahrestätigkeit ist zusätzlich ein externer Meldekanal für Hinweisgeber:innen (Whistleblowing-Kanal) bereitzustellen.
- WIE kann gefördert werden – Förderungsarten
Die Förderungsarten sind nun noch strukturierter gelistet:
- Projektförderungen (für einzelne Vorhaben).
- Jahresförderungen (für die Gesamttätigkeit/laufenden Betrieb von Einrichtungen) – beachte oben Fördervoraussetzungen.
- Stipendien (für Studienaufenthalte, künstlerische Entwicklung, Fort- und Weiterbildung, Nachwuchsförderung, Staatsstipendien).
- Bauvorhaben von überregionalem Interesse.
Zusätzlich können auf Grundlage des Kunstförderungsgesetzes auch Werke angekauft werden, Sachzuwendungen (z.B. Raumüberlassungen) erfolgen sowie Preise und Prämien vergeben werden.
- WELCHE KOSTEN können gefördert werden – Förderbare Kosten
Bei den förderbaren Kosten gibt es drei zentrale Neuerungen:
(1) Inhaltliche Ausweitung der förderbaren Kosten:
- Erstmals förderbar sind Ausgaben zur Verbesserung der Vereinbarkeit von künstlerischer Tätigkeit und Familie ab einer Förderungshöhe von EUR 15.000. Diese sind auf maximal EUR 2.000 gedeckelt und müssen durch Einzelbelege nachgewiesen werden.
- Ebenso explizit förderbar sind Ausgaben zur Stärkung der Inklusion von Menschen mit Behinderung, sofern sie direkt und tatsächlich im Projektzeitraum entstanden sind.
- Auch Ausgaben/Aufwendungen für Präventivmaßnahmen zur Verhinderung von Machtmissbrauch im Kunst- und Kulturbetrieb können geltend gemacht werden, wenn sie im unmittelbaren Zusammenhang mit dem geförderten Vorhaben stehen und in einem angemessenen Verhältnis zur Gesamtförderungssumme.
(2) Einführung einer "Gemeinkosten-Pauschale" bei Projektförderungen:
Bei Projektförderungen sind wie bisher grundsätzlich alle dem Projekt zurechenbaren Ausgaben/Aufwendungen förderbar, die direkt, tatsächlich und zusätzlich (zum herkömmlichen Betriebsaufwand) für die Dauer von Projektbeginn bis Projektende der geförderten Tätigkeit entstanden sind. Sie müssen in unmittelbarem Zusammenhang mit den zu fördernden Projekten stehen, angemessen kalkuliert sein und nachweislich nach Einreichung des Projekts im angegebenen Projektzeitraum angefallen sein. Gewährte Rabatte und Skonti sind in Anspruch zu nehmen und abzuziehen. Soweit, so bekannt.
Neu geregelt ist die Möglichkeit, unter bestimmten Umständen bis zu 20 % der Gesamtkosten für Gemeinkosten (Overhead-Kosten) pauschal geltend zu machen. Diese Pauschale deckt Kostenpositionen ab, sofern sie nicht als direkte Kosten förderbar sind, wie z.B. allgemeine Tätigkeiten von Sekretariat, Controlling, Buchhaltung, Personalverrechnung, Geschäftsführung; Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung; EDV-, Nachrichtenaufwand; Büromaterial, Drucksorten, inkl. Versand; Arbeitsplatzausstattung; Gebäudeabschreibung, Instandhaltung, Reparatur; Miete und Pacht für allgemeine Flächen, Betriebskosten; Reinigung, Entsorgung; Lizenzgebühren (sofern diese die Unternehmensgrundausstattung betreffen); Fachliteratur; Versicherungen, Steuern; und allgemeine Aus- und Weiterbildung. Voraussetzung ist jedoch, dass die Ausschreibung oder der Förderungsvertrag dies ausdrücklich vorsieht und prozentual bzw. betragsmäßig definiert.
(3) Klarere Regelungen bzgl. Umsatzsteuer und Abschreibungen
Umsatzsteuer, Abschreibungen und Investitionen sind nun klarer geregelt und nur unter bestimmten Voraussetzungen förderfähig – etwa bei nicht abziehbarer Umsatzsteuer oder zeitlich begrenzter Nutzung.
- ABRECHNUNG
Die Förderhöhe, bis zu der erleichterte Nachweisbedingungen gelten, wurde von EUR 4.000 auf EUR 7.000 ausgeweitet. Bei Projektförderungen bis zu einer Fördersumme von EUR 7.000 kann von der Vorlage eines zahlenmäßigen Nachweises abgesehen werden; ein Sachbericht (Dokumentation/Tätigkeitsbericht) ist jedoch weiterhin zu erbringen.
Bei der Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Leistungen sind ab einem Auftragswert von EUR 7.000 zu Vergleichszwecken nachweislich mehrere Angebote einzuholen, sofern dies möglich ist.
Einschätzung der Änderungen
Die neuen Richtlinien sind wesentlich umfangreicher und präziser als zuvor. Vieles, was bisher gelebte Praxis oder nur in der Allgemeinen Rahmenrichtlinie geregelt war, wird nun auch explizit in die Kunstförderungsrichtlinie aufgenommen. Das fördert grundsätzlich die Nachvollziehbarkeit für Förderungsnehmende.
Positive Impulse finden sich vor allem in der Anhebung der Schwelle für erleichterte Nachweisbedingungen von EUR 4.000 auf EUR 7.000.
Inhaltlich setzten Impulse vor allem im Bereich Vereinbarkeit, Inklusion und Prävention von Machtmissbrauch an:
So sind in Fortführung des bisherigen Schwerpunkts des Kulturressorts zur Prävention von Machtmissbrauch in Kunst und Kultur nunmehr auch Fördernehmende in der Pflicht: ab einer Fördersumme von EUR 50.000 für Jahrestätigkeiten ist verpflichtend ein Präventionskonzept vorzulegen (wortwörtlich heißt es ein "Konzept zur Prävention von Machtgebrauch"), Ausgaben für Präventivmaßnahmen zur Verhinderung von Machtmissbrauch sind als förderbare Kosten nun unter bestimmten Bedingungen anrechenbar und ab einer Fördersumme von EUR 100.000 ist ein externer Meldekanal für Hinweisgeber*innen (Whistleblowing-Kanal) zusätzlich zum Präventionskonzept bereitzustellen. Diese Bestimmung greifen bereits für Einreichungen für Jahrestätigkeiten 2026 und müssten damit bereits diesen Herbst vorliegen. Da eine derartig schnelle Umsetzung für viele Förderwerbende angesichts der kurzen Vorlaufzeit nur schwer seriös möglich ist, wurde die Möglichkeit eingeräumt, für Einreichung im Jahr 2025 die Konzepte nachzureichen. Das heißt, sie müssen nicht zwingend mit der Antragstellung vorliegen, sondern können bis zum Zeitpunkt der Förderentscheidung bzw. dem Zustandekommen des Fördervertrags nachgereicht werden können. VERA – Vertrauensstelle gegen Belästigung und Gewalt in Kunst, Kultur und Sport soll bei Bedarf unterstützen agieren.
Präzisiert wurde ebenfalls, dass im Rahmen der Förderung künstlerischen Schaffens, seiner Vermittlung und Präsentation auch Maßnahmen zur Stärkung der Inklusion von Menschen mit Behinderung förderbar und entsprechende Kosten abrechenbar sind. Qualitativ handelt es sich hierbei um "kann-Bestimmungen", verpflichtend sind weiterhin lediglich die geltenden Rechtsvorschriften des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetztes sowie das Behinderteneinstellungsgesetz.
Ein neuer Impuls findet sich in der Möglichkeit, erstmals Ausgaben zur Verbesserung der Vereinbarkeit von künstlerischer Tätigkeit und Familie geltend zu machen. Die Ausgestaltung ist vorerst jedoch noch relativ strikt: Sie ist mit maximal EUR 2.000 gedeckelt, muss durch Einzelbelege nachgewiesen werden und ist grundsätzlich erst ab einer Förderhöhe von EUR 15.000 für Projekt- und Jahrestätigkeiten möglich. Der Begriff künstlerische Tätigkeit soll, so wurde zumindest versichert, nicht nur für Künstler*innen sondern auch für Kulturarbeiter*innen mit vergleichbaren Arbeitserfordernissen gelten. Wenn auch ausbaubar, so verstehen wir diese Maßnahme zumindest als wichtigen ersten Schritt einer Pilotphase, die – so sie sich bewährt – bei zukünftigen Revisionen entsprechend auszuweiten sein wird.
Manche Bestimmungen, obwohl nicht neu, können weiterhin für Irritation sorgen. Dazu gehört etwa die Möglichkeit einer Kürzung der Förderung, wenn Förderungsnehmende eine höhere als ursprünglich vereinbarte Eigenleistung erbringen oder erbringen können oder das geförderte Projekt Einnahmen erzielt, die bei Antragstellung noch nicht geplant oder angegeben waren. Kommt es zu einer entsprechenden Rückforderung, muss der Rückzahlungsbetrag verzinst werden. Die neuen Richtlinien legen hierbei eine Verzinsung von 3 % über dem jeweils geltenden Basiszinssatz pro Jahr fest, falls ein Verschulden am Rückforderungsgrund vorliegt. Dies ist eine Reduzierung gegenüber den alten Richtlinien, die 4 % pro Jahr vorsahen. Es bleibt jedoch weiterhin fraglich, welchen Anreizeffekt diese Bestimmungen auf die Steigerung der Eigenmittel haben soll – nicht zuletzt auch mit Blick auf die Erwartungshaltung an Kulturorganisationen, ihre Eigenmittel zu steigern um eine eine bessere Entlohnung ihrer Mitwirkenden in Richtung "Fair Pay" zu ermöglichen oder noch viel grundsätzlicher: um wirtschaftlich erforderliche Rücklagen durch Zufallsgewinne zu bilden, die notwendig sind um in Zeiten, in denen Regierungswechsel und Budgetverhandlungen zu großen zeitlichen Verzögerungen bei Förderentscheidungen führen, schlichtweg zahlungsfähig zu bleiben und Mitarbeitende und Räume halten zu können.
Evaluiert werden die neuen Richtlinien spätestens 2027, also ein Jahr vor ihrem Auslaufen im Juni 2028.